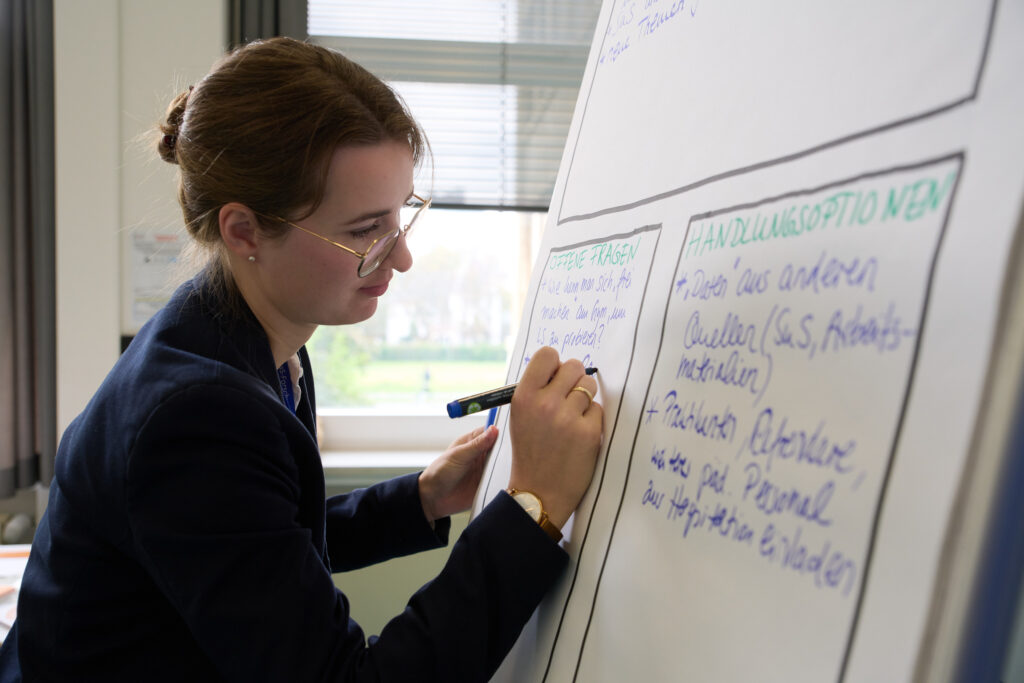Länderübergreifender Austausch zur Potenzialförderung: Regionale LemaS-Jahrestagung in Frankfurt
Ein letztes Mal hieß es in diesem Jahr „Wissen multiplizieren – Transfer gestalten – Potenziale fördern“. Damit schließt die Goethe-Universität Frankfurt am 29. und 30. September als vierte Tagung die Reihe der regionalen Jahrestagungen von „Leistung macht Schule“ (LemaS) ab. Ziel der Veranstaltungen war es, begabungsfördernde Schul- und Unterrichtsentwicklung vertieft zu bearbeiten und nachhaltig in die Breite zu tragen. Zuvor fanden bereits Tagungen an der Universität Münster, der Universität Rostock und der Humboldt-Universität zu Berlin statt.
Die Gastgeber:innen in Frankfurt aus den Regionalzentren Mitte-West und Süd ermöglichten den Austausch der fünf Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland und brachten rund 130 Schul- und Landesmultiplikator:innen aus mehr als 40 Schulnetzwerken mit Vertreter:innen aus Wissenschaft, Bildungsadministration und Politik zusammen. In praxisorientierten Workshops wurden Möglichkeiten zur Verankerung und Weiterentwicklung der LemaS-Ansätze in der Schulpraxis diskutiert. Ergänzend fanden Fachvorträge zu aktuellen Forschungsergebnissen und -entwicklungen statt.
Die Netzwerkarbeit im Mittelpunkt
Nach den digitalen Eröffnungsreden der Bundesbildungsministerin Karin Prien und der Präsidentin der Bildungsministerkonferenz, Sabine Oldenburg, in denen die Bedeutung von „Leistung macht Schule“ auch mit Blick auf mehr Chancengerechtigkeit betont wurde, eröffneten die Projektleitung des Regionalzentrums Mitte-West Prof. Dr. Barbara Asbrand und die Verbundkoordinatorin Prof. Dr. Gabriele Weigand den ersten Veranstaltungstag. Dabei wurde insbesondere das Potenzial der länderübergreifenden Vernetzung betont und das gemeinsame Format der beiden Regionalzentren als wertvolle Gelegenheit für Begegnung und Austausch hervorgehoben.
Prof. Asbrand: „Von den teilnehmenden Lehrkräften haben wir die Rückmeldung bekommen, dass sie den Austausch mit den Kolleg:innen aus den anderen Bundesländern als sehr bereichernd erlebt haben. Die Transferkonzepte der anderen Bundesländer kennenzulernen, also der berühmte „Blick über den eigenen Tellerrand“, wurde als hilfreich erlebt, um die eigene Praxis besser einschätzen und reflektieren zu können.“
Lernen neu denken
Den inhaltlichen Auftakt bildete die Keynote von Prof. Dr. Anke Langner und Schulleiterin Maxi Hess, die in enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis den Schulversuch an der Universitätsschule Dresden gestalten. Der Vortrag gab umfassende Einblicke in die schulorganisatorischen Prozesse und Lernformate, die individuelle Lernwege und Leistungsnachweise in kooperativen Lernsettings ermöglichen. Dabei wurden neben konzeptionellen Überlegungen auch umfassende Einblicke in die praktische Umsetzung der im Schulversuch zentralen Projektarbeit ermöglicht. In der regen Diskussionsrunde am Ende des Vortrages untermalte Prof. Dr. Langner die Bedeutung des Schulversuchs als Impulsgeber für innovative Schulen.
Prof. Langner betonte: „Durch die grundlegende Ausrichtung auf die Begleitung und Unterstützung individueller Entwicklungswege sowie die Nutzung spezifischer Instrumente der Lernprozessbegleitung wird es an der Universitätsschule Dresden möglich, die vielfältigen Begabungen der Schüler:innen sichtbar zu machen und darauf aufbauend gezielte Lern- und Förderprozesse zu gestalten. Wir können zeigen, dass eine grundlegende Neuausrichtung von Schule gelingen kann – was sich auch in den Leistungen unserer Absolvent:innen widerspiegelt.“
Fotos: Alex Becker
Gelebter länderübergreifender Austausch
Am Nachmittag des ersten Tages konnten sich die Teilnehmenden in insgesamt 19 Workshops zu Schulentwicklung, Transfer- und Netzwerkarbeit austauschen und konkrete Fragestellungen sowie Forschungsergebnisse bearbeiten. Auch hier zeigte sich in den Arbeitsgruppen das Potenzial des länderübergreifenden Konzepts und die aktive Wissenschaft-Praxis-Kooperation. So rückten beteiligte Länder mit Dr. Jürgen Flender (Hessen), Lukas Götz (Baden-Württemberg) beispielsweise ihre landesspezifischen Instrumente im Kontext von „Leistung macht Schule“ in den Fokus oder Schulleiterin Anja Frühwirth von der UNESCO-Grundschule Würzburg-Heuchelhof stellte ihre Erfahrungen und Ideen in Bezug auf die Verbindung von LemaS und Startchancen-Programm an ihrer Schule zur Diskussion.
Praxisnahe Workshops
Am zweiten Veranstaltungstag standen die Inhaltscluster (IC) im Mittelpunkt. Die Kolleg:innen der fachübergreifgenden Schul- und Unterrichtsentwicklung (IC2), Unterrichtsentwicklung MINT (IC3) sowie Sprachen (IC4) gestalteten in neun praxisnahen Workshops ein vielfältiges Programm. Nachdem die Zusammenarbeit zwischen den Multiplikator:innen und den wissenschaftlichen Teams im Schuljahr 2024/25 vor allem digital stattfand, bot das Treffen in Frankfurt die Gelegenheit zur persönlichen Begegnung und zum intensiven Austausch mit den Vertreter:innen aus Schulpraxis, Bildungspolitik, Landesinstituten und Wissenschaft. Damit wurde der Tag zu einem Forum für fachlichen Dialog, kollegiale Vernetzung und konkrete Planungsschritte für die weitere Arbeit im Projekt und in den Schulnetzwerken.